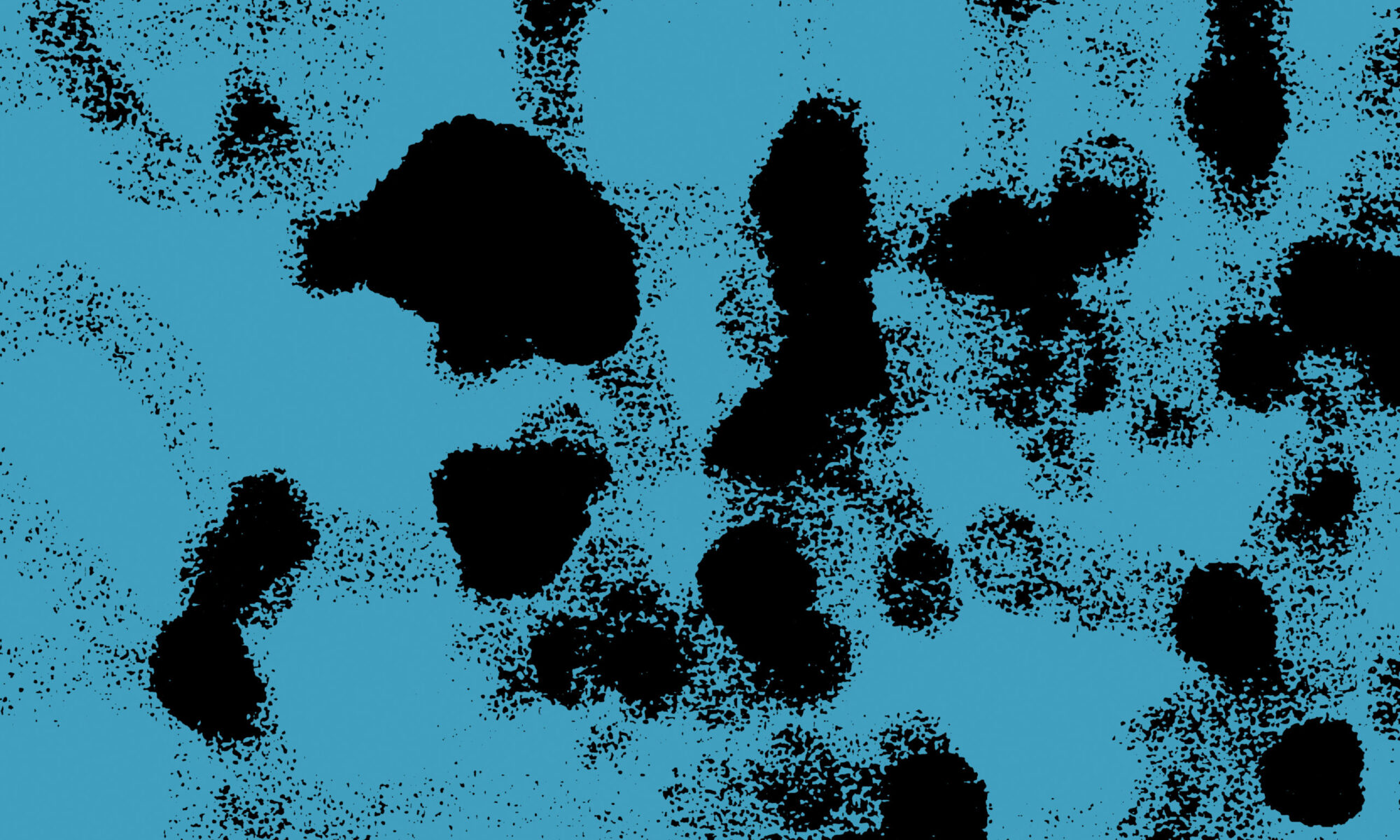Wir finden zunächst viele Beispiele für Versprechen. Da ist natürlich das Eheversprechen, das Freundschaftsversprechen, ein Versprechen zu helfen, da zu sein, etwas bestimmtes zu tun oder zu unterlassen. Häufig sind es Sätze zu anderen in der Form: Ich verspreche dir (…). Durch ein Versprechen wollen wir Vertrauen in einer Beziehung schaffen. Mit der Einhaltung von Versprechen wächst das Vertrauen in die Beziehung.
Versprechen haben die Funktion, Vertrauen einer Beziehung zu schaffen.
Diesmal werden in den Beispielen gegensätzliche Auffassungen deutlich. Da ist auf der einen Seite das Argument, dass Versprechen etwas sehr Wertvolles sind, die darum auch unbedingt einzuhalten sind. Auf der anderen Seite wird das Argument vertreten, dass zum Zeitpunkt des Versprechens niemals alle zukünftigen Bedingungen vorher gesehen werden können. Daher sollten Versprechen auch auflösbar sein.
Ein Versprechen bezieht sich immer auf einen zukünftigen Sachverhalt, der von der Gegenwart aus nicht vorhersehbar sein kann.
Da ist zum Beispiel das Versprechen, die Eltern bis zum Tod zu Hause zu begleiten und wenn notwendig zu pflegen. Nun kann der Aufwand nicht mehr bewältigt werden und den Eltern geht es nicht gut zu Hause. Da ist das Versprechen, beim Umzug zu helfen. Jetzt ist ein Urlaub geplant oder eine Erkrankung kommt dazwischen. Da ist das Versprechen, bis zum Lebensende miteinander in der Ehe zu leben. Nun ist die Liebe erloschen und das Zusammenleben unerträglich geworden.
Treten unvorhersehbare Umstände ein, kann oder will ich mein Versprechen möglicherweise nicht einhalten.
Aber ist es gerechtfertigt, den hohen Wert eines Versprechens aus persönlichen Gründen in Frage zu stellen, indem ich mein Versprechen nicht einhalte? Was wird dann aus diesem Wert? Es werden Beispiele genannt von Lebensbereichen, in denen ein Versprechen nicht mehr viel gilt. Da sind die Versprechen der Werbung, immer wieder Versprechen von Politikern, manchmal auch Versprechen von Handwerkern und Autowerkstätten.
Werden Versprechen immer wieder nicht eingehalten, schwindet unser Vertrauen.
Wenn aber auf der einen Seite klar ist, wir können nicht alle Versprechen einhalten, auf der anderen Seite jedoch ebenso erfahrbar, dass die Einhaltung eines Versprechens erst seinen Wert begründet, wie kommen wir nur aus dieser Klemme heraus? Einerseits ist uns der Wert an sich wichtig, andererseits fordern uns in der Lebenspraxis ständig neue Bedingungen heraus.
Wir geraten in ein Dilemma zwischen dem Wert eines Versprechens und den sich wandelnden Anforderungen der Welt an uns.
Aus diesem Grund erscheint uns nun einzig eine geregelte Auflösbarkeit eines Versprechens als Lösung. Da ist der Vorschlag, wer ein Versprechen annimmt, kann dieses auch wieder zurück geben, wenn Argumente und Gründe dies rechtfertigen. Da ist der Vorschlag, ich sei bei sehr wesentlichen Veränderungen der Gründe für ein Versprechen nicht mehr an mein Versprechen gebunden.
Es scheint, dass die Ausnahme von der Regel erst ein moralisches Gebot bekräftigt.
Ein Versprechen ist immer einzuhalten, das ist die Regel. Das moralische Gebot entsteht erst durch die notwendige Ausnahme von der Regel. Wir sind moralisch herausgefordert als Menschen. Regeln befolgen können bereits Automaten.