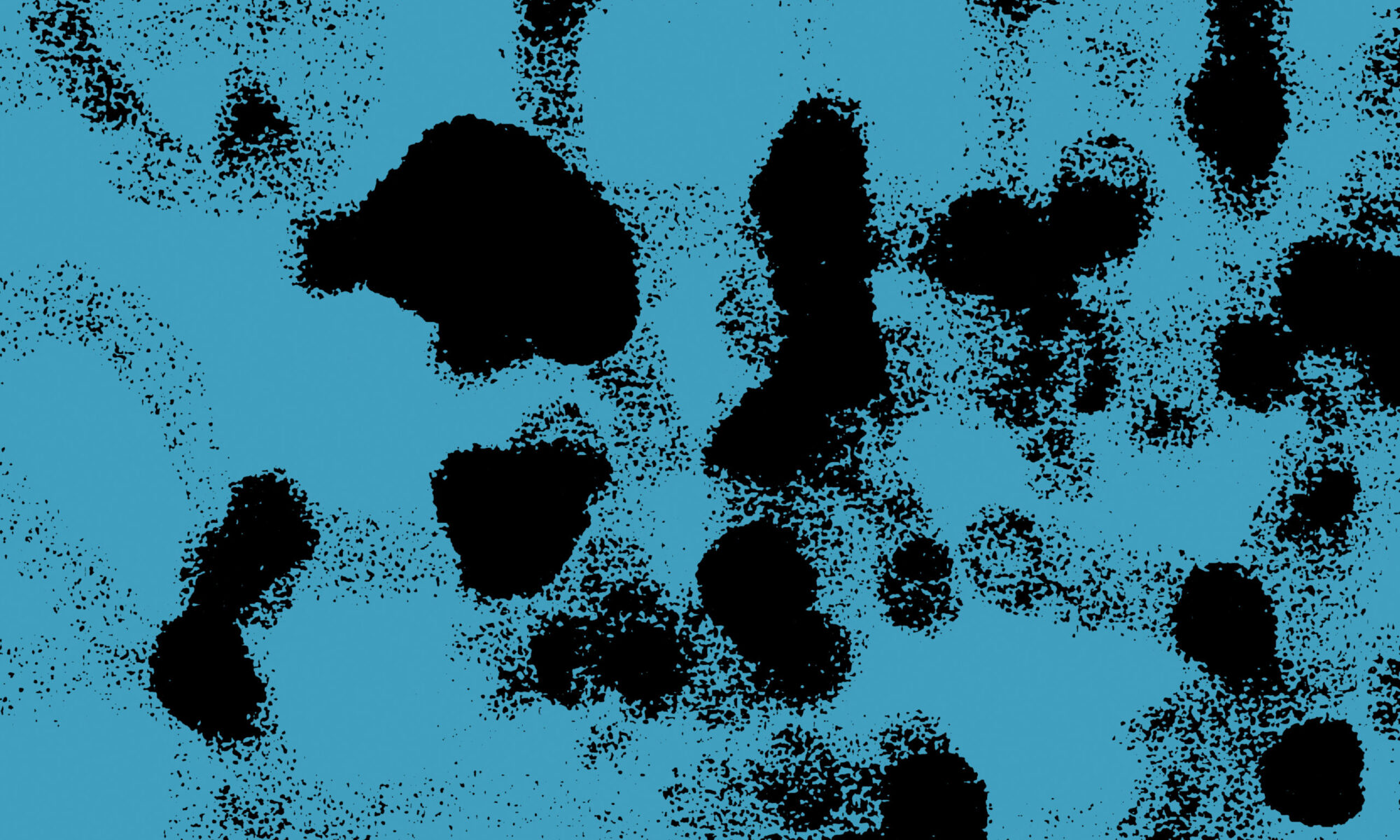Wir starten mit Beispielen für etwas, in das wir vertrauen. Genannt werden die Naturgesetze, dass die Sonne aufgeht, ein Apfel immer nach unten fällt. Dann auch nahe Angehörige, Partner:innen, Kinder, Eltern. Schließlich auch uns selbst. Und sicher auch in unsere Sterblichkeit.
Vertrauen kann sich auf ganz unterschiedliche Dinge oder Menschen beziehen.
Nur, können wir wirklich so ganz sicher vertrauen? Fast alle haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen Vertrauen enttäuschen oder gar missbrauchen können. Die Naturgesetze werden ständig neu gefasst in den Wissenschaften. Die Schwerkraft, wie wir sie für verlässlich halten, gilt nur in einer ganz bestimmten Region unseres Planeten, vom Erdboden bis in ein paar tausend Meter Höhe. Wie oft haben wir uns in uns selbst getäuscht? Einzig der Tod scheint so ganz sicher. Doch dann braucht es unser Vertrauen nicht.
Vertrauen mag nur dort einen Sinn haben, wo wir keine Gewissheit haben.
Damit erscheint unsere Frage in einem ganz anderen Licht. ein wir auf das vertrauen, dessen wir nicht sicher gewiss sind, so ist die Frage nach dem „wirklich vertrauen“ hinfällig. Oder zumindest wird das Vertrauen zu einer Entscheidung. Ich vertraue zum Beispiel dir. Sicher habe ich gute Gründe dazu. Nicht jedem schenke ich mein Vertrauen. Jedoch, wüsste ich ganz sicher, dass ich nicht enttäuscht werden kann, so müsste ich nicht vertrauen.
Vertrauen scheint vor allem eine Entscheidung zu sein, auf etwas oder eine Person zu vertrauen.
Warum tun wir Menschen das? Eine Antwort darauf ist, weil wir nicht anders können. Würden wir nichts und niemandem, vertrauen, so könnten wir unseren Alltag nicht leben. Wir können einfach nicht alles und jeden kontrollieren. Abgesehen davon, dass wir es auch aus moralischen Erwägungen nicht wollen. Dennoch sind wir auf der anderen Seite frei zu entscheiden, auf welche Bereiche sich unser Vertrauen erstreckt.
Das wir vertrauen hat auch einen moralischen Aspekt.
Wir können und wollen vertrauen und entscheiden uns für die Dinge und Menschen, denen wir vertrauen. Diese Gabe an Vertrauen wird möglicherweise erwidert und es entsteht ein Netz von Vertrauen. Dieses Netz hält nicht nur uns, sondern auch viele andere. Es entsteht eine Ethik des Vertrauens. Das mag auch der Grund dafür sein, dass wir stets an etwas Gutes denken, wenn wir vertrauen.
Zu vertrauen und Vertrauen zu bestätigen lässt ein stabiles soziales Netz entstehen.
Sicher haben Menschen und auch Dinge zu allen Zeiten Vertrauen enttäuscht. Jedoch ist der grundsätzliche Sinn von Vertrauen dadurch nicht eingeschränkt.
Es ist gut zu vertrauen.