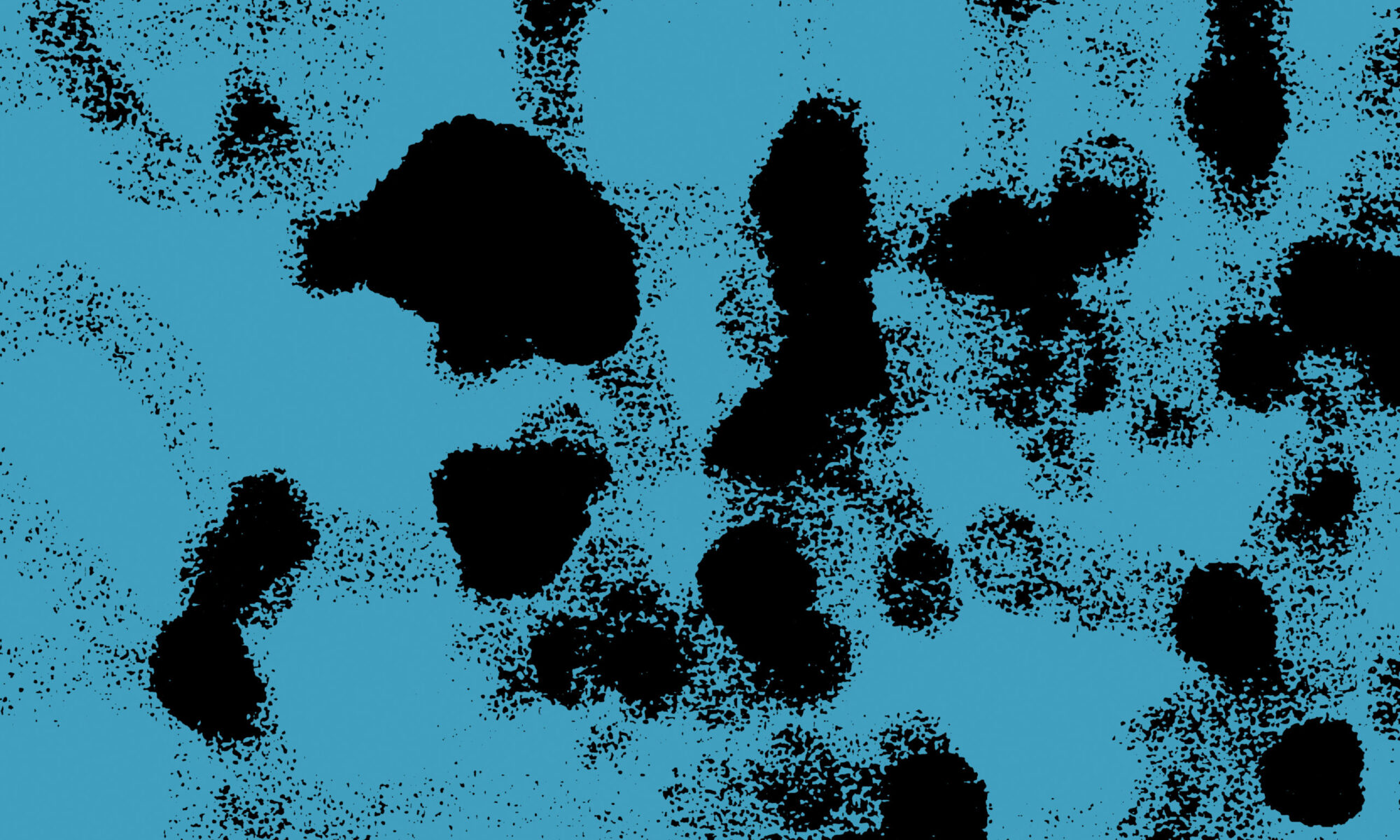Heute ist eine Antwort offensichtlich: Natürlich gibt es die ewige Liebe! Als Hoffnung, als Vorstellung, als Idee, als Wunsch. Aber finden wir auch Beispiele, in denen wir dies wirklich erfahren haben? Zumindest gibt es Hinweise. Da ist die Erfahrung einiger der elterlichen Liebe. Sie fühlen sich geliebt von den Eltern als Kinder und auch als Erwachsene. Vielleicht trägt diese Erfahrung der Liebe sogar über den Tod hinaus.
In der Liebe der Eltern finden wir ein Motiv bedingungsloser Liebe.
Da ist der Glaube an einen liebenden Gott oder eine andere spirituelle Erfahrung des geliebt Seins durch etwas Größeres als uns selbst. Der Idee nach sollte diese Liebe ewig sein. Doch es gibt auch Skepsis, ob wir davon Gewissheit haben können. Möglicherweise ist diese Vorstellung nur ein erdachter Trost. Vielleicht sogar hält uns diese Vorstellung davon ab, selbst zu lieben.
Auch im Glauben an einen liebenden Gott oder in einer spirituellen Erfahrung der Liebe finden wir Motive ewiger Liebe.
Schließlich finden wir auch in der Möglichkeit der Selbstliebe eine Möglichkeit „ewiger“ Liebe, zumindest lebenslang. Doch wir sind nicht einig, was diese Liebe zu sich selbst begründet. Ist es die elterliche Liebe? Die göttliche? Eine universelle Energie? Einige weisen darauf hin, dass wir zumeist eher geliebt sein wollen als selbst zu lieben.
Im Motiv der ewigen Liebe kann der Wunsch geliebt zu sein erkannt werden.
Nur wenn wir alle „ewig“ geliebt sein wollen, wer liebt dann? Wir kommen auf Beziehungsthemen zu sprechen. Es wird berichtet von Beziehungen, die nicht ewig dauern, sondern enden. Da ist die eine, bei der es trotz Trennung noch Gefühle von Liebe gibt. Da ist eine andere, nach der alle Hoffnung in eine andauernde tiefe Liebe verloren ist. Ist die romantische Liebe und eine darin begründete Beziehung überhaupt mit dem Ideal ewiger Liebe vereinbar?
Die romantische Liebe scheint der Vorstellung ewiger Liebe zu widersprechen.
Vielleicht sind verhandelte Beziehungen ohne romantische Gefühle eine Lösung? Oder ist es gerade anders herum, nur in der leidenschaftlichen Hingabe an einen anderen Menschen kann sich die ewige Liebe zeigen? Zumindest scheint die ewige Liebe nicht mit einer bestimmten Liebesbeziehung identisch, sondern Letztere ist vielleicht nur ein innerweltlicher Ausdruck ewiger Liebe.
Die erfahrene Liebe mag vielleicht ein Hinweis auf die Existenz der ewigen Liebe sein.
Wenn wir lieben können wir anderen diese Erfahrung ermöglichen. Vielleicht ist die ewige Liebe nichts weiter als die Gesamtheit der erfahrenen Liebe in der Welt.