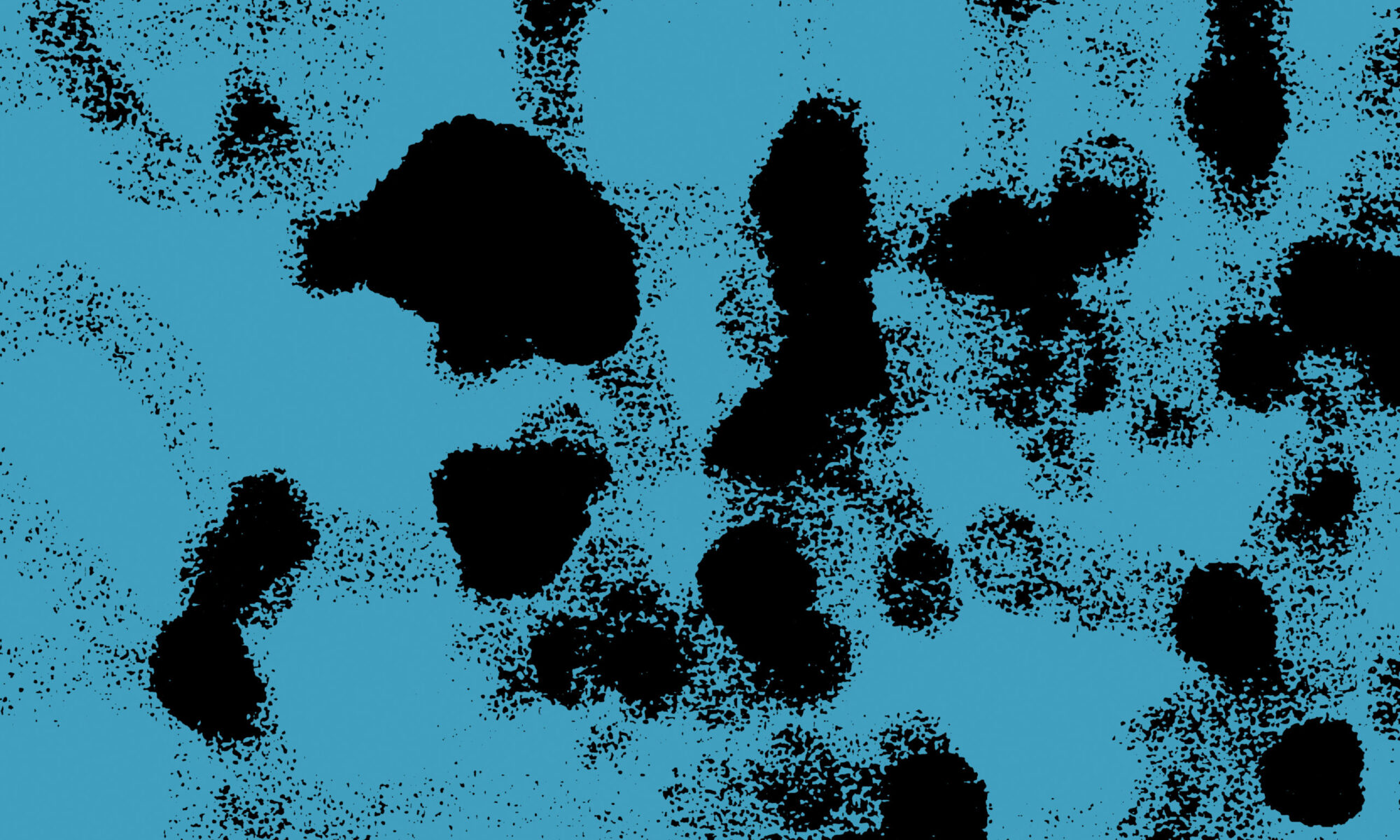Zunächst einmal fallen uns viele Beispiele ein, in denen wir uns für andere schämen. Da ist die Frau mit dem verschobenen Make-up und dem viel zu durchsichtigen Kleid, die dies offensichtlich selbst nicht bemerkt. Da ist der eigene Mann, der einfach nicht tanzen kann. Da ist der Tischnachbar, der alle guten Manieren vermissen lässt. Die eigene Mutter auf dem Dorffest, wie sie jedem, der es nicht vermeiden kann, ausführlich aus ihrem Leben erzählt.
Wir können für andere Scham empfinden, auch wenn sie sich selbst nicht schämen.
Nur warum tun wir dies? Verantwortlich fühlen wir uns nicht. Es sei denn wir handeln und klären zum Beispiel die Situation auf. Doch dann hört die Scham auf. Das Schamgefühl hingegen hält uns in der Nicht-Verantwortung. Oder vielleicht entsteht das Schamgefühl für andere gerade aus der im Nicht-Handeln angestauten Energie.
Die Scham für andere wird so zu einem moralischen Gefühl.
Ob wir uns schämen oder nicht, stellt uns in einen moralischen Zusammenhang mit unserer Mitwelt. Ist es angemessen so oder so zu handeln, sich so oder so zu geben, mit anderen so oder so in Bezug zu gehen? Wir beantworten diese Frage mit einem moralischen Gefühl, der Scham. Fehlte uns diese, so fehlte ein wichtiges Regulativ im sozialen Leben.
Die Scham für andere ist Motiv und Antrieb für unser Handeln.
Handeln wir in Verantwortlichkeit für andere, so verschwindet die Scham. Bleiben wir im entrüsteten oder irritierten Nicht-Handeln, so bleibt ein unangenehmes Gefühl in uns bestehen. Doch woher nehmen wir das Mass von Angemessenheit, von dem oben die Rede war? Ist dieses nicht willkürlich und abhängig von unseren kulturellen Gesetzen und sozialen Erfahrungen? Die Scham für andere stellt selbst auch eine dieser Gesetze und Erfahrungen dar.
Die Scham für andere ist Teil des dynamischen sozialen Geschehens und damit an der Entstehung unseres moralischen Gefühls beteiligt.
Wir schämen uns für andere, weil wir es als soziale Wesen können. Wir handeln moralisch, wenn wir über die Scham hinaus wachsen und uns fragen, auf welche Verantwortlichkeit die Scham verweist. Damit gehört die Scham für andere, wie die Scham für uns selbst und andere soziale Gefühle zu den Grundlagen unseres moralischen Vermögens.