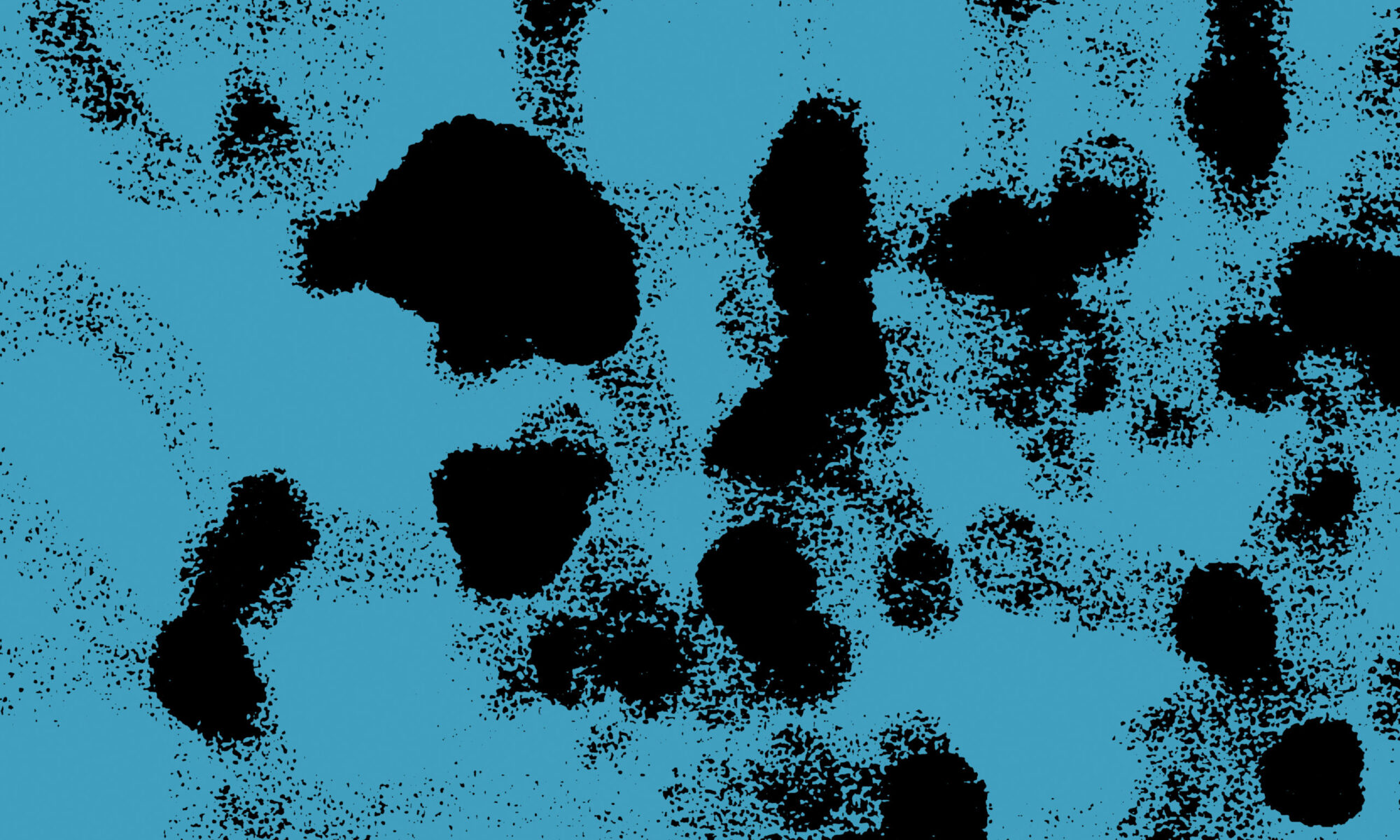Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegane Ernährung. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, manche persönlich, manche beanspruchen allgemein verbindlich zu sein.
Gelten die humanistischen Ideale, dass alle Wesen gleich viel wert sind und daher Anspruch darauf haben, nur um ihrer selbst willen zu sein, für alle Lebewesen gleichermaßen?
Wir sammeln Beispiele. Jemand erinnert sich daran, dass es in seiner Kindheit auf dem Land üblich war, mit den Tieren zu leben und auch manchmal eines davon zu schlachten und zu essen. Ein anderer erzählt die Geschichte, dass ein ganzes Dorf auf die Jagd ging und anschließend die Wildtiere in den Höfen und an den Straßen aufgehängt waren. Neugierig erkundeten die Kinder die toten Tierkörper.
Menschen und Tiere leben miteinander und manchmal voneinander.
Es gibt auch Widerspruch zu dieser Perspektive. Menschen in jochindustrialisierten Kulturen können sich entscheiden, auf Tiere als Nahrung zu verzichten. Oder zumindest Maß zu halten. Als Gründe hierfür werden das ökologische Argument und das Entsetzen über die industrielle Massentierhaltung genannt. Tiere sind hier ökonomisch verwertete Produkte, ihr Leben hat nur den Wert der Verwertbarkeit als Nahrungsmittel.
Es gibt ein ethisches Moment in der Ernährung. Wir sollten uns fragen, was wir essen wollen.
Wenn wir Tieren ein Recht zusprechen, müssen wir uns jedoch auch fragen, wie wir es mit der Zucht von Haustieren allgemein halten. Es ist schwierig zu bestimmen, was ein dem Tier gerechtes Leben eines Zuchtwelpen sein kann.
Es ist vielleicht weniger die Frage nach unveräußerliche Rechten der Tiere. Es scheint vielmehr die Frage notwendig zu stellen, in welcher ethischen Haltung wir Menschen in der Welt sein wollen.
Hier können wir fernab von ideologischen Diskussionen uns aufklären.