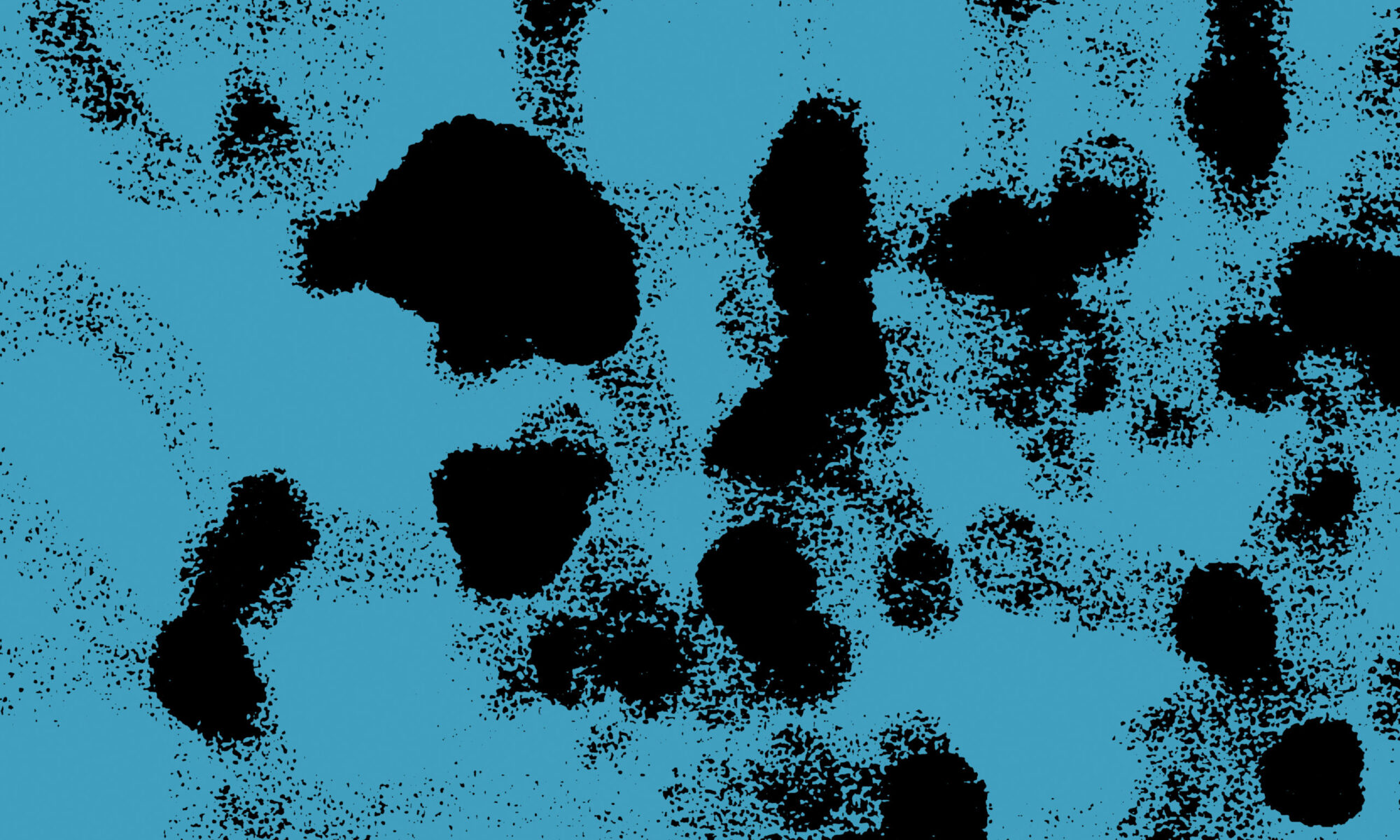Diesen Abend ist es nicht schwer, Beispiele zu finden und es steigt sich deutlich die große Kraft der sokratischen Haltung und Methode. Ausgehend von alltäglichen Beispielen gelangen wir Philosophierend zu allgemeinen philosophischen Aussagen. Vom „kürzesten Weg zwischen zwei Menschen“ – einem Lächeln – bis zur Frage der Existenz selbst reichen dabei die Argumente. Doch langsam der Reihe nach.
Wir beschreiben zunächst verschiedene Ebenen von Verbindung. Zum einen kann Verbindung entstehen, wenn wir uns schlichtweg begegnen. Mit einem Lächeln, mit einer Frage, mit einem Anliegen oder auch in einer Notlage. Dann kann Verbindung auch technisch erzeugt sein, über das Telefon, einen Videocall, Medien allgemein. Auch können viele Menschen über ein Thema verbunden sein, ohne sich individuell zu kennen, in einem Fußballstadion, einer politischen Initiative, einer Religion.
Verbindungen können in direkter Begegnung oder auch technisch oder durch ein gemeinsames Thema vermittelt entstehen.
Und hier entsteht auch bereits ein erster Dissens: sind dies alles bereits Verbindungen? Oder sollten wir unterscheiden zwischen Verbindungen und zum Beispiel Begegnungen oder Kontakten? Zumindest scheint es unterschiedliche Qualitäten von Verbindungen zu geben. Einige gehe ich freiwillig ein, andere nicht, wie zum Beispiel in der Familie. Auch kann sich die Verbindlichkeit der Verbindungen erheblich unterscheiden, zum Beispiel zwischen einer engen Freundschaft oder Partnerschaft und einem freundlichen Grüßen in der Nachbarschaft. Und da ist auch die Kollegin, die vielleicht gar nicht mit mir in Verbindung sein möchte.
Verbindungen können sich in ihrer Verbindlichkeit deutlich unterscheiden.
Überhaupt scheint der Wortstamm Verbindung/Verbindlichkeit bedeutsam zu sein. Ich gehe eine Verbindung ein und binde mich an eine andere Person. Dies ist sogar in existenzieller Hinsicht lebensnotwendig, zumindest zu Beginn des Lebens. Ohne Verbindung kein Überleben. Damit wird nun auch das Lösen einer Verbindung wichtig. Vielleicht möchte ich gar nicht in Verbindung sein oder zumindest nicht mehr oder nicht in der Qualität.
Was mich in Verbindung bringt, erzeugt zugleich etwas, das eine Verbindung lösen kann.
Und da ist schließlich auch die Zeit, in der Verbindungen geschlossen werden und wieder gelöst. Freundschaften, Liebesbeziehungen, Arbeitsverträge, Ausbildungsgänge, Schulzeiten … Ja, auch mein Leben kann ich betrachten als eine immer enger werdende Verbindung mit mir selbst, vielleicht dann und wann in einer Krise unterbrochen und schließlich im Tod aufgehoben. Denn um eine Verbindung zu erleben, braucht es den Abstand zwischen mir und den anderen, zwischen mir und mir selbst.
Was uns in Verbindung bringt, sollte zugleich uns auseinander halten.
Vielleicht ist dies ein Trost, wenn wir uns nicht genug verbunden fühlen.