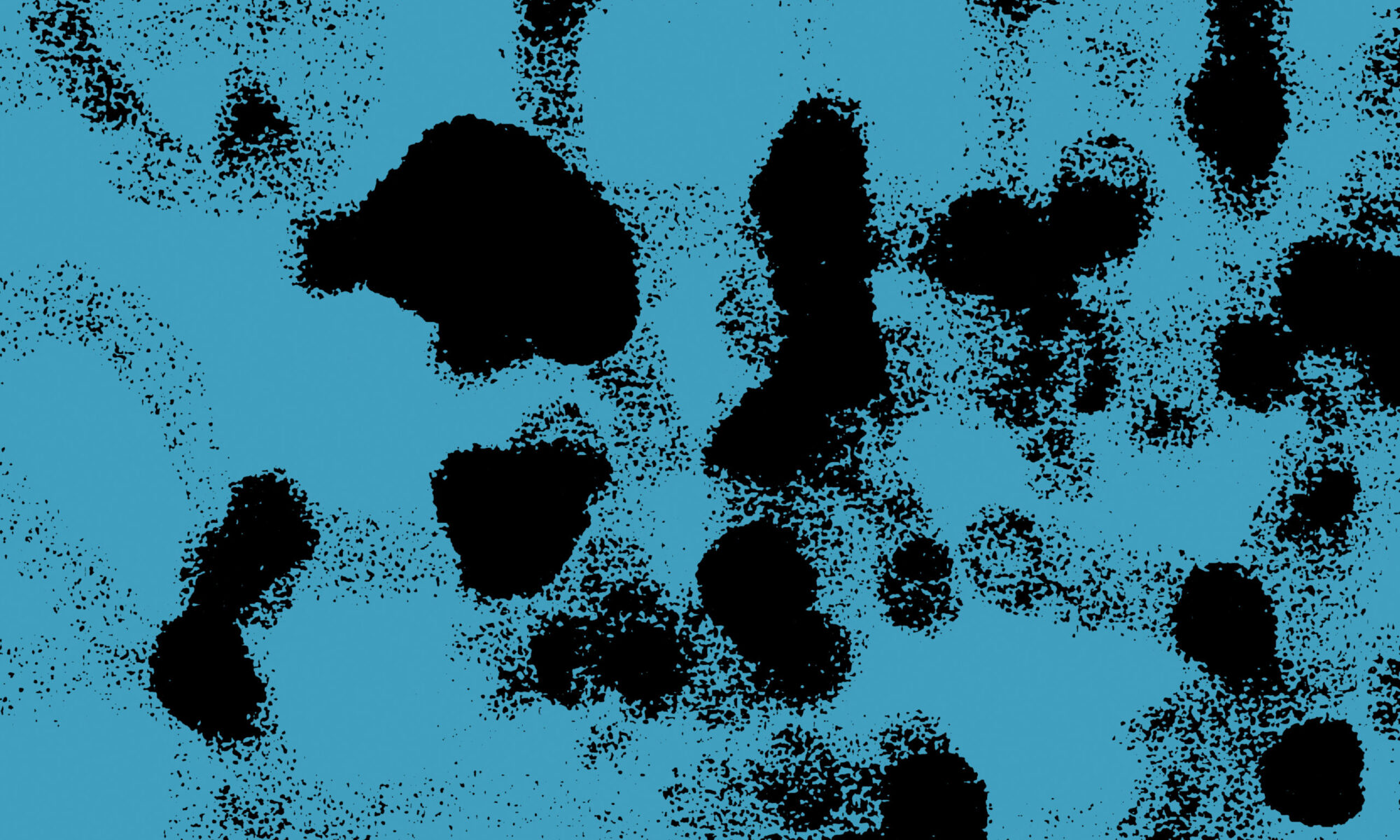Ein wundervoller Abend mit vielen spannenden Beiträgen der Teilnehmenden. Wir beginnen natürlich mit der Frage nach „dem Bösen“. Was ist das überhaupt? Und: gibt es „das Böse“? Wir finden Beispiele: wenn eine Person mich absichtlich belügt oder täuscht, um einen Vorteil zu erlangen. Wenn eine Person mir absichtlich Schaden zufügt oder mich willentlich verletzt. Und sicher auch: wenn eine Person mit Absicht eine andere Person ums Leben bringt.
Eine mögliche Bestimmung des Bösen liegt scheinbar in der Absicht oder im Motiv einer Person begründet.
Damit kommt jedoch auch ein zweiter Aspekt mit hinzu: die Person muss die Folgen seines Handelns für eine andere Person abschätzen können, damit Absicht unterstellt werden kann. Wenn ein Kind Schaden oder Verletzung durch sein Handeln herbei führt, ist es eher nicht „böse“, denn es kann oft nicht abschätzen, was passieren wird. Jedoch scheint es für erwachsene Personen dennoch unmöglich, das Motiv von außen zu erkennen. Ein „gutes“ Motiv scheint schnell behauptet und war dies auch das Motiv des Handelns?
Das Motiv einer Handlung kann oftmals nicht sicher bestimmt werden.
Damit bleibt es also bei den Folgen einer Handlung. Ein Kind kommt im Straßenverkehr ums Leben. Ein Soldat stirbt bei Kampfhandlungen. Eine Person vergiftet Tauben im Park. Ein wohnungsloser Mensch erfriert im Winter. Ein anderer unterschlägt eine Dose Cola an der Selfscan Kasse. Es scheint leider auch nicht sicher möglich zu entscheiden, wer oder was hier „böse“ ist.
An den Folgen einer Handlung kann das Böse ebenfalls nicht immer eindeutig bestimmt werden.
Es scheint unbeantwortbar, was „böse“ ist. Und doch haben wir alle Beispiele im Kopf, was wir als „böse“ empfinden. Die Zuschreibung „böse“ scheint wichtig zu sein im sozialen Leben. Vielleicht gibt sie uns das Gefühl, dass zu einem schlimmen Ereignis immer auch eine Person verantwortlich gemacht werden kann. Oder dass ich „besser“ bin als andere Personen.
Das „Böse“ erscheint oftmals als eine Zuschreibung anderen Personen und deren Handlungen gegenüber.
Auch Institutionen oder Gruppen werden als „böse“ bezeichnet: die Regierung, der Staat, bestimmt gesellschaftliche Gruppen. Fast immer bezeichnen also Personen andere Personen oder Gruppen oder Institutionen als „böse“. Eine Folge einer unterstellen Handlung und ein unterstelltes Motiv dazu bilden die Grundlage dazu. Kurz: wir erschaffen das „Böse“ in unserer Vorstellung.
Möglicherweise erschafft die Idee des „Bösen“ selbst erst das Böse.
Können wir es also dann auch einfach abschaffen? Nun, zumindest möchten nicht alle darauf verzichten, eine verwerfliche Tat auch als „böse“ zu bezeichnen, als eine Art Verstärkung des Arguments gegen diese Tat. Und zugleich auch bedeutet eine solche Verurteilung einer Tat immer einen Ausschluss einer Person, welcher eine „böse“ Tat unterstellt wird. Denn: „böse“ sein bedeutet, nicht mehr dazu zu gehören zu den redlichen und guten Menschen, welche diese Unterscheidung in die Welt bringen. Und: ist es nicht „böse“, eine andere Person auszuschließen?
Doch vielleicht ist dies eine erst zukünftige mögliche gesellschaftliche Entwicklung …