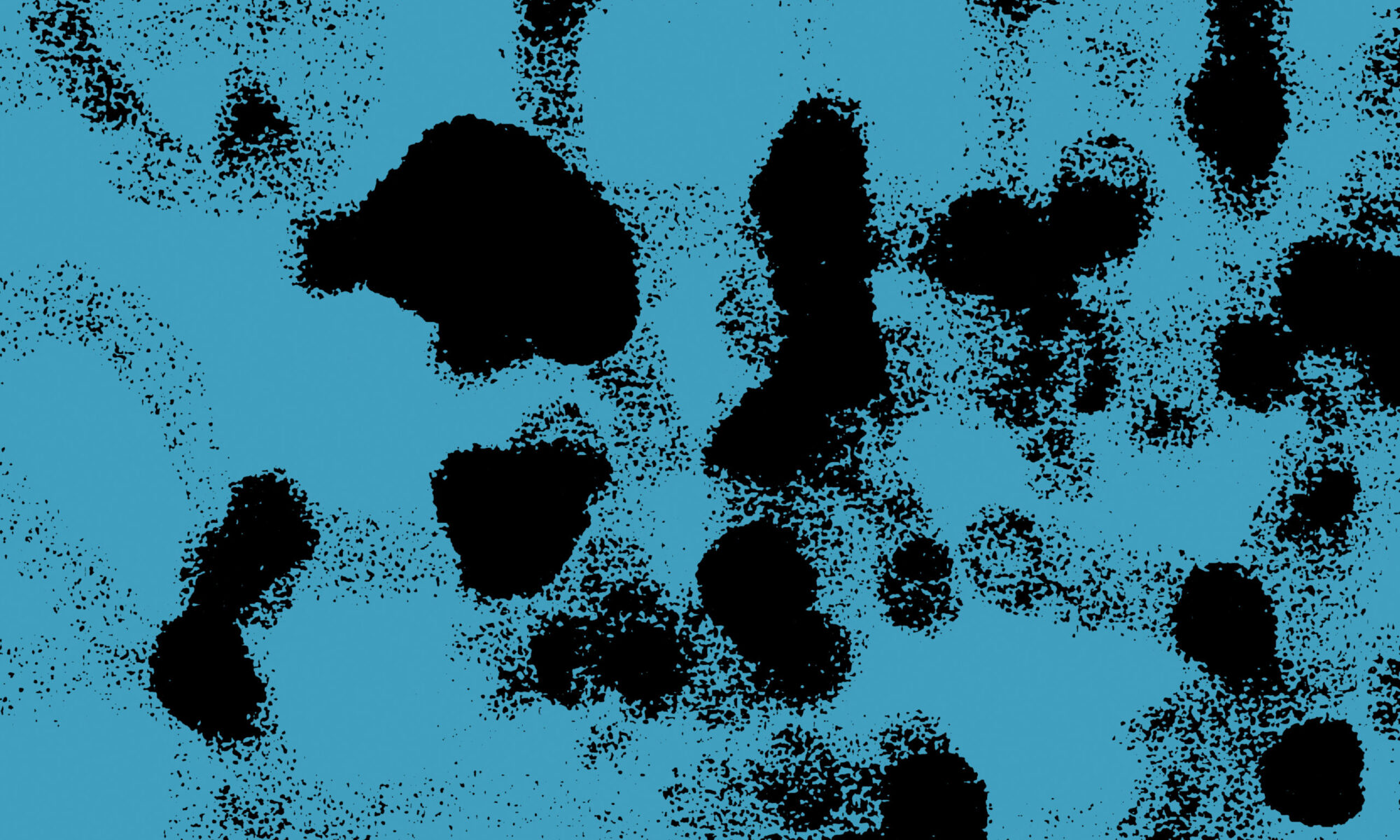Diesmal in der Sonderausgabe! in großer Runde. Die Teilnehmenden können nicht nur im Plenum miteinander ins Gespräch kommen, sondern auch nach der Pause an den Tischen gleichzeitig parallel. Die dadurch entstehenden vielfältigen Gesprächsfäden können hier nur in Auszügen nachvollzogen werden.
Zunächst einmal stellen wir fest, dass es Zeiten gibt im Alltag, die durch vielfältige Pflichten und „müssen“ bestimmt sind. Dies wird von den Meisten als unfrei wahrgenommen. Dagegen wünschen wir uns Zeit, die wir frei gestalten können. Zum Beispiel in unserer Freizeit, wo wir einem Hobby nachgehen. Hier haben wir meist den Eindruck, dass wir dem Leben freien Lauf lassen. Aber ist dem auch so?
Mit der Fragestellung stoßen wir auf die Widersprüchlichkeit der Freiheit selbst.
Auch wenn ich meine Zeit frei gestalte ohne äußere Zwänge, so lasse ich dem Leben selbst oft doch nicht seinen freien Lauf, eben weil ich gestalte. Hingegen kann ich an meinem Arbeitsplatz sehr wohl dem Leben freien Lauf lassen, wenn ich akzeptiere, dass ich keine Kontrolle über die Gestaltung der Zeit habe. Nehme ich gelassen hin, dass in dieser Zeit mein Chef oder ein bestimmter Arbeitsablauf mein Handeln bestimmt, vollziehe ich nach, wie mein Leben in diesem Moment gerade ist.
Unser Leben scheint weit mehr zu sein, als unser Wunsch nach freier Zeitgestaltung.
Wenn ich meine freie Zeit aktiv gestalte, ist noch gar nicht entschieden, ob ich dem Leben freien Lauf lasse. Immer wenn ich mich – meinetwegen frei – für etwas entscheide, habe ich ein Stück Freiheit meines Lebens eingeschränkt, eine Richtung eingeschlagen, andere Wege zurück gelassen. Wenn ich zum Yoga gehe, kann ich zu Hause nicht mit meiner Familie sein. Freiheit habe ich vor der Entscheidung, nachdem ich ausgewählt habe, sind meine Lebensmöglichkeiten dadurch bestimmt.
Dem Leben freien Lauf zu lassen führt uns zu einem inneren Konflikt.
Wie gelange ich zu einer freien Entscheidung? Und mit welcher Haltung begegne ich den gegebenen Möglichkeiten? Und ich kann mich nicht nicht entscheiden. Vielleicht also einmal nicht lange nachdenken, sondern den „Bauch“ entscheiden lassen? Was könnte das philosophisch bedeuten? So könnte ich mich bewusst dazu entscheiden, einen noch unbekannten Weg zu gehen. Hinein in ein noch Unbekanntes.
Im noch Unbekannten kann ich dem Leben mit Neugier begegnen.
Meine Denkgewohnheiten bieten mir Sicherheit. Ich kenne mich aus in meinem Beruf. Ich kenne die Menschen in meiner Familie. Meine Freunde können von mir erwarten, dass ich sie nicht enttäusche. Doch nur wenn ich diese Gewohnheiten verlasse, öffne ich mich dem Leben gegenüber.