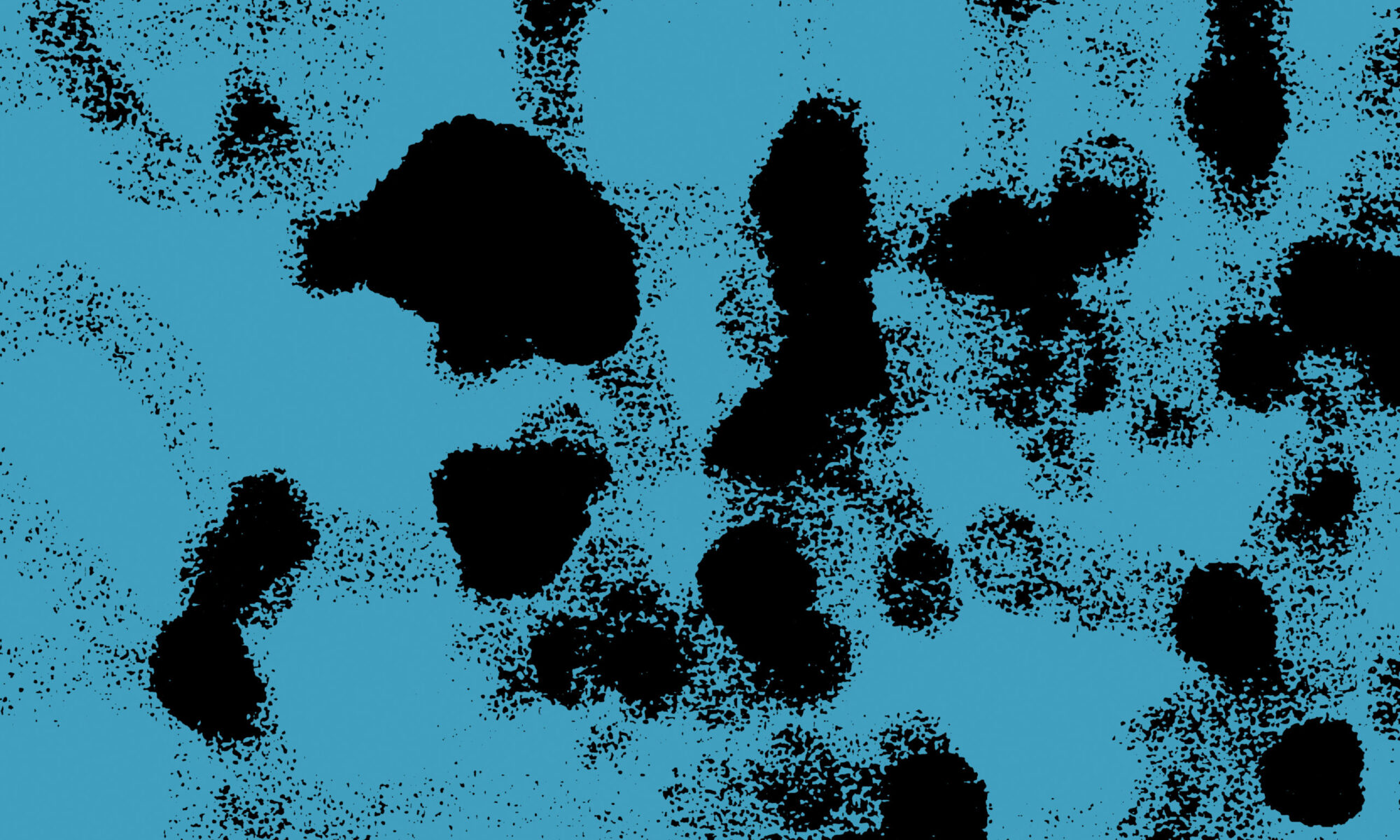Wir kommen sehr schnell in ein Gespräch über die Liebe zunächst. Was verstehen wir unter „Liebe“? Wir finden sehr verschiedene Beispiele. Liebe könne ein Gefühl sein, dass mich überkommt. Oder auch ein Gefühl, für das ich mich entscheide, es wahrzunehmen. Oder manchmal auch ein Zustand, in dem ich mich in bestimmter Weise wahrnehme. Oder gar, wenn mir alle Vorstellungen und Gefühle durcheinander geraten. Und nicht zuletzt, kann die Liebe mich auch „blind“ machen.
Liebe kann sehr verschiedene Formen des Erlebens und Wahrnehmens betreffen.
Nun soll es uns heute um Formen des „Liebens“ gehen, wenn ich also „tätig“ bin. Und wieder finden wir viele Formen des Liebens. Ich kann meine:n Partner:in lieben. Meine Eltern. Meine Kinder. Menschen meiner Familie. Meine Freunde. Besondere Menschen. Mein Idol. Vielleicht auch alle Menschen? Nun, das scheint den meisten etwas zu weit gefasst. Jedoch auch immer mich selbst. Was den meisten als das Schwierigste erscheint. Aus dieser Perspektive kann ich schon immer mehrere Menschen lieben.
Je nach meiner Vorstellung von „Lieben“ kann ich auch mehrere Menschen lieben.
Und wie sieht es aber in der romantischen Liebe aus? Da wäre zunächst das Verliebtsein. Hier fällt es uns auf, dass in der Regel ein anderer Mensch geradezu „rauschhaft“ geliebt wird. Nicht unbedingt muss dies erwidert sein. Schön ist es dennoch. Und dann? Für die eine beginnt dann eine Liebesbeziehung, in der Vertrauen und Bindung wachsen kann. Für einen anderen die Möglichkeit überhaupt erst, sich bewusst zu lieben. Das sei jedoch oft auch schwer und voller „Klippen“. Für eine andere beginnt dann eine schwierige Zeit, scheint es ihr doch unmöglich, nur einen Menschen zu lieben.
In der romantischen Liebe wird die Möglichkeit, nur einen anderen Menschen zu lieben, unterschiedlich bewertet.
Schließlich ist die Entscheidung für nur eine:n ausschließliche:n Beziehungspartner:in eine zwar kulturell in vielen Fällen gedeckte, jedoch immer nur eine mögliche Entscheidung. Wir können auch anders entscheiden. Da berichtet eine, dass sie eine Zeit lang eine „Liebe zu dritt“ gelebt hat. Nach einer Zeit sei dies jedoch gescheitert. Ein anderer erzählt von einer Liebe, welche offen ist für andere Beziehungen. Sexuelle, platonische, freundschaftliche. Und dann wirft eine andere noch ein, dass schließlich viele solcher Nebenbeziehungen „heimlich“ stattfinden. Wir scheinen in der Klemme zu stecken zwischen unseren kulturellen und sozialen Prägungen und unserem Begehren zu lieben, was unser Herz uns eingibt.
Sofern wir immer schon mehrere Menschen lieben, bleiben wir auch stets auf der Suche nach Möglichkeiten für unser Begehren zu lieben.
Eine Kontroverse erscheint in diesem Zusammenhang. Für einige ist das Lieben eine Praxis, das was die vielen einzelnen Menschen miteinander tun. Für einige andere bedeutet Lieben eine universelle und vielleicht spirituelle Energie. Für die einen entsteht aus der Liebespraxis der einzelnen erst „Liebe“. für die anderen ist die Praxis des Liebens eine Ausdrucksform einzelner für etwas bereits im Universum vorhandenes, deren Teil sie werden. Möglicherweise gibt es auch beide Bewegungen, die sich irgendwo in Raum und Zeit umschlingen. Dies zumindest würde die Verwirrungen des Liebens erklären.
Ob du nun bewusst viele Menschen liebst oder nur eine:n (ganz besonders). Zu lieben scheint die beste Entscheidung zu sein, die du treffen kannst.