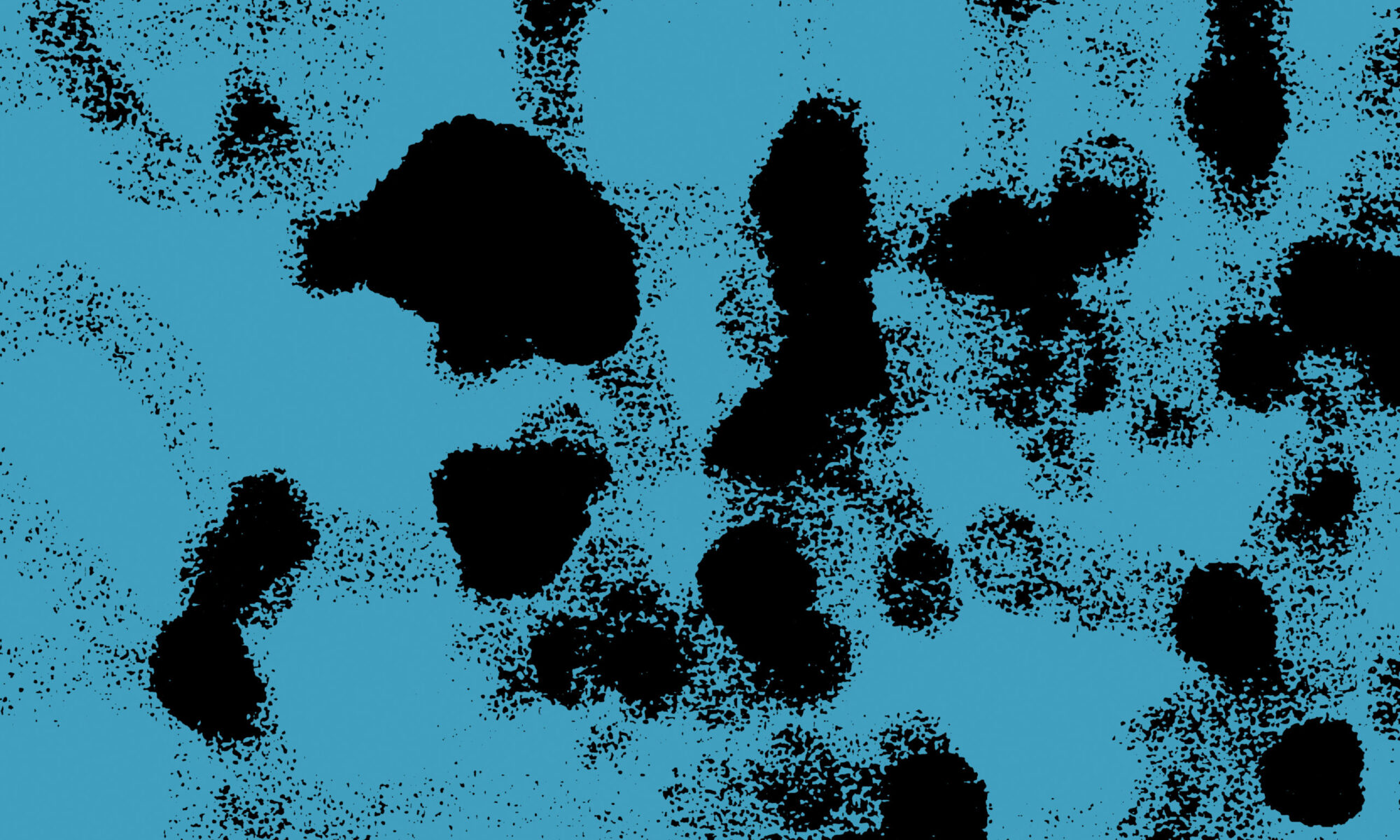Wir sind uns zunächst nicht einig, was wir mit dem Wort „Begehren“bezeichnen. Es kann unsere sexuellen Wünsche meinen, aber aushandele Wünsche, wie Glück oder ein neues Auto oder nur eine Kugel Schokoladeneis. Wir suchen verschiedene ähnliche Worte, wie „Lust“, „Bedürfnis“, „Begierde“, „Sehnsucht“. Schließlich bleiben wir bei einer gewissen Unbestimmtheit.
Mit Begehren scheinen wir etwas noch nicht Bestimmtes zu bezeichnen, dass wir jedoch für die nahe Zukunft wollen.
Schokoladeneis, Lebensglück, eine*n Partner*in, eine schöne Wohnung. Wir können vieles begehren. Begehren kann spontan sein oder auch langfristig. Begehren strebt immer nach Erfüllung. Jedoch folgt auf die Erfüllung nicht immer das ersehnte Gefühl. Ich kann mein Begehren immer auch körperlich wahrnehmen. Manchmal sogar schmerzhaft oder leidvoll.
Begehren scheint sich stets auch den Körper, die Gefühle, Wahrnehmungen und Empfindungen einzuschließen.
Wenn wir über unser Begehren sprechen, ist es daher oft ein Wunsch oder gar ein Appell, den wir an andere richten. manchmal ist das lustvoll, auch für die andere. Ich fühle mich begehrt, ich begehre und mein Begehren wird erwidert. Manchmal ist es das nicht.
Mein Begehren ist das Begehren der anderen.
Mein Begehren, von anderen begehrt zu werden, kann ich auch auf andere Art befriedigen. Mit dem Besitz oder dem Wunsch nach Objekten, Dingen oder Substanzen kann ich mein Begehren kompensieren. Meist merke ich das jedoch schmerzlich. Ich brauche immer mehr davon. Die Erfüllung meines vorgeblichen Begehrens nutzt sich ab. Eine Wiederholung hilft nicht mehr.
Im Begehren nach Dingen oder Substanzen kann ich mein Begehren begehrt zu werden kurzfristig kompensieren.
Welchen Ausweg gibt es noch? Ich kann mein Begehren in der Schwebe halten. Mich äußern ohne den Appell nach Erfüllung?
Über mein Begehren sprechen ohne dabei die Erwartung auszudrücken, die andere möge mein Begehren erfüllen.