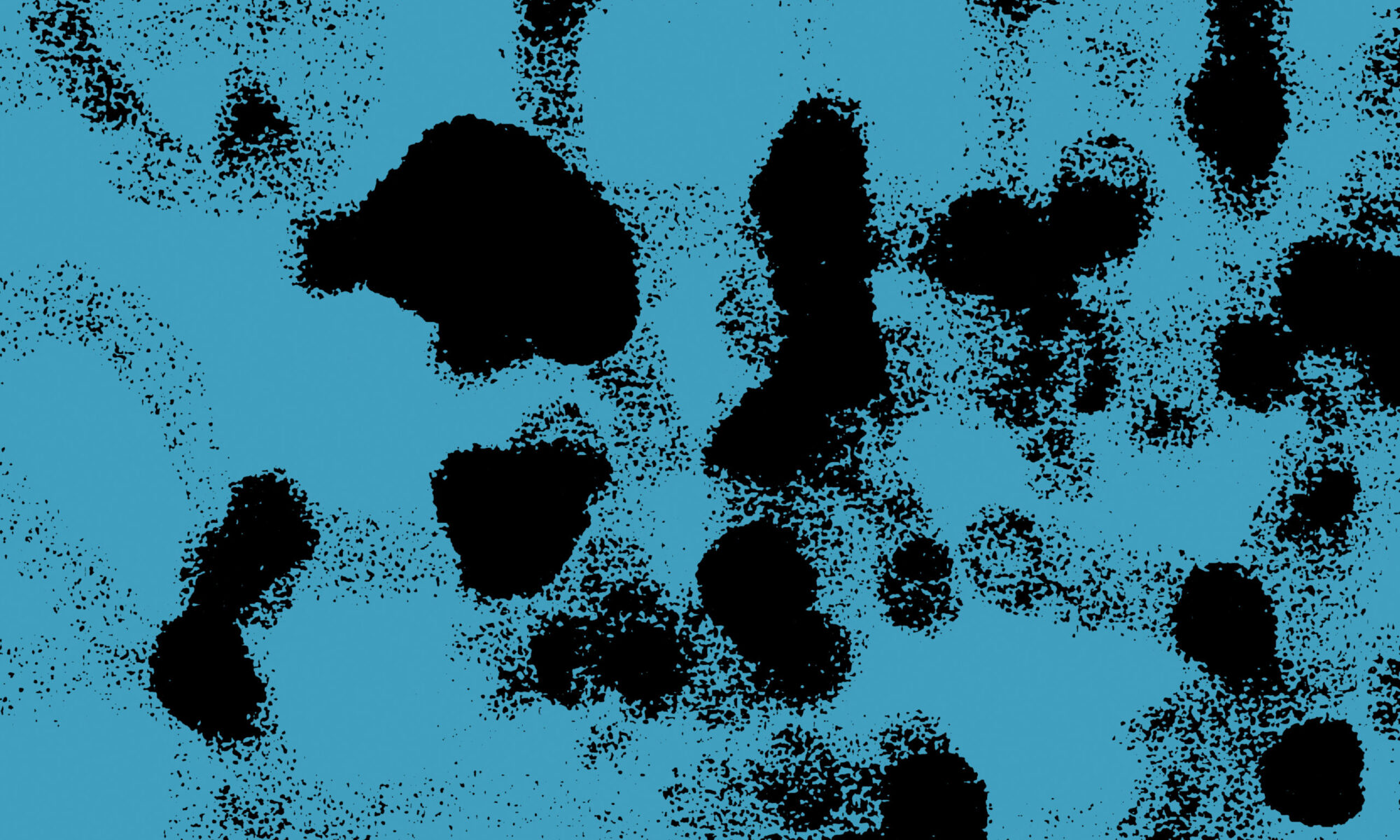„Philosophieren hält deine Seele gesund!“ Diese oder ähnlich lautende Behauptungen sind uns überliefert von Philosoph*innen des antiken Griechenland. Im Kern meinten sie damit, sich mit sich selbst und der Welt auseinander zu setzen, seine Werte zu kennen, eine eigene Haltung zu entwickeln, seine Emotionen zu beherrschen und sich allgemein bewusst zu verhalten.
Psychologen an der Charité in Berlin haben vor einiger Zeit untersucht, ob wir auch heute noch von diesen „Weisheitskompetenzen“ profitieren können (Baumann & Linden 2008). Sie kamen zu dem Ergebnis, dass diese seit der Antike bekannten Fähigkeiten in der heutigen Zeit nicht nur gesundheitsförderlich sondern auch erlernbar sind. Philosophieren zeigt sich somit als ein möglicher Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden.
Denn wer philosophiert, der trainiert ganz bestimmte Fähigkeiten und Haltungen: Sich in die Perspektive anderer hinein versetzen, mit anderen Menschen mitfühlen, eigene Gefühle wahrnehmen und zum Ausdruck bringen, die eigenen Werte begründen und zugleich die Werte anderer anerkennen, zu sich selbst in Distanz gehen und nicht zuletzt auch eine Akzeptanz von Ungewissheit in der Welt.
Diese ihrem Ursprung nach philosophischen Kompetenzen verhelfen uns dazu, dass wir uns von belastenden Ereignissen besser distanzieren können, bessere Bewältigungsformen haben, erworbene Lebenserfahrungen auf neue Situationen übertragen können, uns mehr mit dem Wohlbefinden von anderen befassen und weniger an vergangenen unangenehmen Ereignissen festhalten.
Aus Rückmeldungen zu meinen philosophischen Cafés und in meinen Coachings habe ich erfahren, dass Menschen vielfältig profitieren und sich persönlich weiter entwickeln. Philosophieren kann helfen und darin bestärken, Krisen zu überwinden und schwierige Lebensentscheidungen zu treffen, Beziehungen zu klären und Trennungen zu verarbeiten, sich selbst besser zu verstehen und mit sich und der Welt in Harmonie zu sein. Es geht in Bestem philosophischen Sinn darum den Mut zu haben, selbst zu denken.
Wenn du nun Lust hast, diesen Weg auszuprobieren, dann komme gern in mein Philosophisches Café oder frage ein Coaching an, in Düsseldorf oder auch online. Gerne informiere ich dich mehr dazu in einem persönlichen Erstkontakt oder Kennenlerngespräch.
auch veröffentlicht unter (externer Link) https://jostguidofreese.de/uncategorized/warum-philosophieren-gut-fuer-deine-gesundheit-und-dein-wohlbefinden-ist/