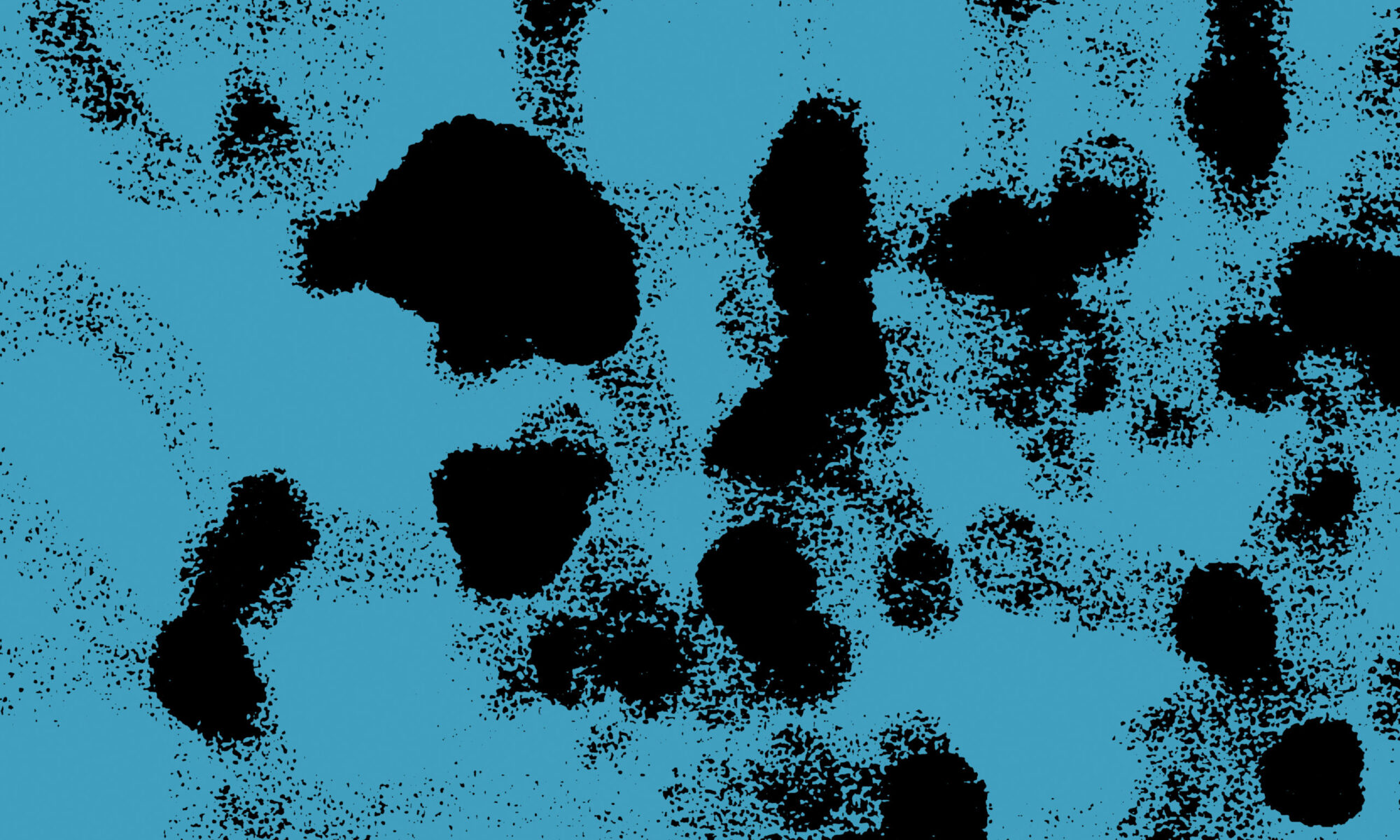Zunächst fallen uns viele Beispiele dafür ein, wenn die Macht mit uns Negatives macht. Da wird eine WG von der Polizei durchsucht ohne Gerichtsbeschluss auf einen vagen Verdacht hin. Da kann ein Chef aufgrund seiner Position ungerechte oder auch unsinnige Entscheidungen durchsetzen. Ein anderer fühlt sich ohnmächtig gegenüber einem Hausbesitzer, der viel Geld und Beziehungen hat.
Die Macht kann unsere Grenzen überschreiten, für uns entscheiden und macht uns manchmal ohnmächtig.
Aber was ist, wenn wir selbst Macht haben? Zunächst halten wir uns alle für überhaupt nicht mächtig. Aber da sind einige, die Eltern sind. Diese Macht bedeutet Verantwortung für andere anzunehmen. Andere sind Vorgesetzte. Neben der Verantwortung für andere bedeutet dies auch Verantwortung für ein Unternehmen, ein Produkt, für die Kunden.
Die Macht macht uns verantwortlich, sie gut und angemessen einzusetzen.
Doch scheint uns Vieles daran nur allzu menschlich. Wir stöhnen und klagen unsere Machtlosigkeit an. Die mächtigen Anderen nutzen ihre Macht nicht angemessen. Wir erkennen unsere Freunde nicht mehr, mit denen wir uns einmal gleich fühlten, die nun heute mächtig sind.
Die Macht verändert uns, wir fühlen uns mächtig gut.
Manche vermuten den Menschen als ein Wesen, dass von sich aus nach Macht strebt. Um endlich nicht mehr anderen folgen zu müssen. Um endlich ganz frei von Zwang zu sein. Aber wir sind uns nicht einig. Manche meinen auch, wir könnten die Macht, sondern wir sie besitzen, auch einfach mit allen teilen. Dann sei keiner mehr mächtig und keiner mehr unterdrückt.
Eine Welt, in der keiner mehr Macht über niemanden hat, ist vielleicht eine Utopie.
Und dann sind wir selbst die Mächtigen und haben endlich Einfluss. Könnten wir in unserem Unternehmen für gerechte Arbeitsbedingungen sorgen? Wenn wir Eltern sind, könnten wir nicht frei und gewaltlos unsere Kinder erziehen? Wenn ich ein Haus besitze, könnte ich dann andere fair dort wohnen lassen?
Wir alle sind oft mächtiger als wir meinen.
Wenn wir uns darauf besinnen, welche Macht wir haben, jeden Tag unsere Beziehungen zu anderen zu gestalten, welche Welt könnte entstehen?